
Prof. Dr. Andreas Fickers, Professor für Zeitgeschichte und digitale Geschichtswissenschaft an der Universität Luxemburg, Direktor des Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History (C²DH) und Beiratsmitglied des Zentrums Erinnerungskultur, thematisierte am 11.03.2025 im Rahmen der Reihe „Debatten und Positionen zur Erinnerungskultur“ die Herausforderungen, vor die digitale Echtzeitarchive die Zeitgeschichte und die Public History stellen.
Dabei warf er die Frage auf, wie der vergängliche Charakter von „living archives“ im Allgemeinen und von digitalen Quellen im Besonderen das Erinnern, das Vergessen, aber auch unser generelles Verständnis von Geschichtsschreibung verändert. Der Vortrag stieß auf breites Interesse und versammelte rund 30 Zuhörende im H25 der Universität.
Ausgangspunkt der Überlegungen von Andreas Fickers war die These, dass die digitale Revolution durch den beschleunigten Datenaustausch und die globale Vernetzung zu einem Zusammenfallen von Gegenwart und Vergangenheit in einer „breiten Gegenwart“ (Hans Ulrich Gumbrecht) bzw. einem „présent monstre“ (François Hartog) geführt habe. Dieser Präsentismus, aber auch Veränderungen der digitalen Forschungsinfrastruktur, des Umfangs und der Zugänglichkeit von Datensätzen sowie neue Werkzeuge der Datenverarbeitung veränderten, so Fickers, nicht nur die Art und Weise, wie Historiker:innen Fragen und Forschungsperspektiven entwickelten, sondern auch wie sie Geschichte interpretierten und erzählten.
Anschließend ging der Zeithistoriker auf sogenannte „lebendige Archive“ ein, die in Echtzeit digital archivieren. Beispiele für solche „Gedächtnisbanken“ der Alltagsgeschichte sind die in vielen Ländern während der Covid-19-Pandemie entstandenen „Corona-Archive“, die Erinnerungen, Alltagserfahrungen und auch (digitale) Fundstücke zur „Corona-Krise“ sammeln. Daneben sind in den letzten Jahren, z. B. in der Ukraine oder in Syrien, Archive entstanden, die Kriege in Echtzeit dokumentieren. Solche digital gespeicherten und gemeinschaftlich betreuten „living archives“ würden, so Fickers, für die digitale Geschichtsschreibung grundlegende praktische, erkenntnistheoretische und ethische Fragen aufwerfen, die bislang oft an die Archivwissenschaften „ausgelagert“ worden seien.
So fehlten in den in Krisenzeiten entstandenen Echtzeitarchiven, insbesondere wenn nachvollziehbarerweise anonyme Beiträge zugelassen würden, mitunter wesentliche Kontextinformationen für die Quellen- und Datenkritik, z. B. die Information, von wem eine Fotografie gemacht und eingestellt wurde, wo sie entstanden ist und was sie genau zeigt. Ohne diese Informationen sind die entsprechenden Quellen nicht nur schwerer auffindbar, sondern auch für die künftige Forschung kaum noch nutzbar. Fickers plädierte deshalb dafür, bereits in der Ausbildung von Historiker:innen, ein Bewusstsein für die Bedeutung der Metadatengenerierung und Anreicherung digitaler Quellen zu schaffen. Zudem stellte er das japanische Cultural Heritage Disaster Risk Management Center vor, ein bislang einzigartiges Projekt, das im Falle einer Naturkatastrophe eine Krisentaskforce entsendet, die „vor Ort“ hilft, professionelle Standards für eine zeitnahe Dokumentation zu etablieren.

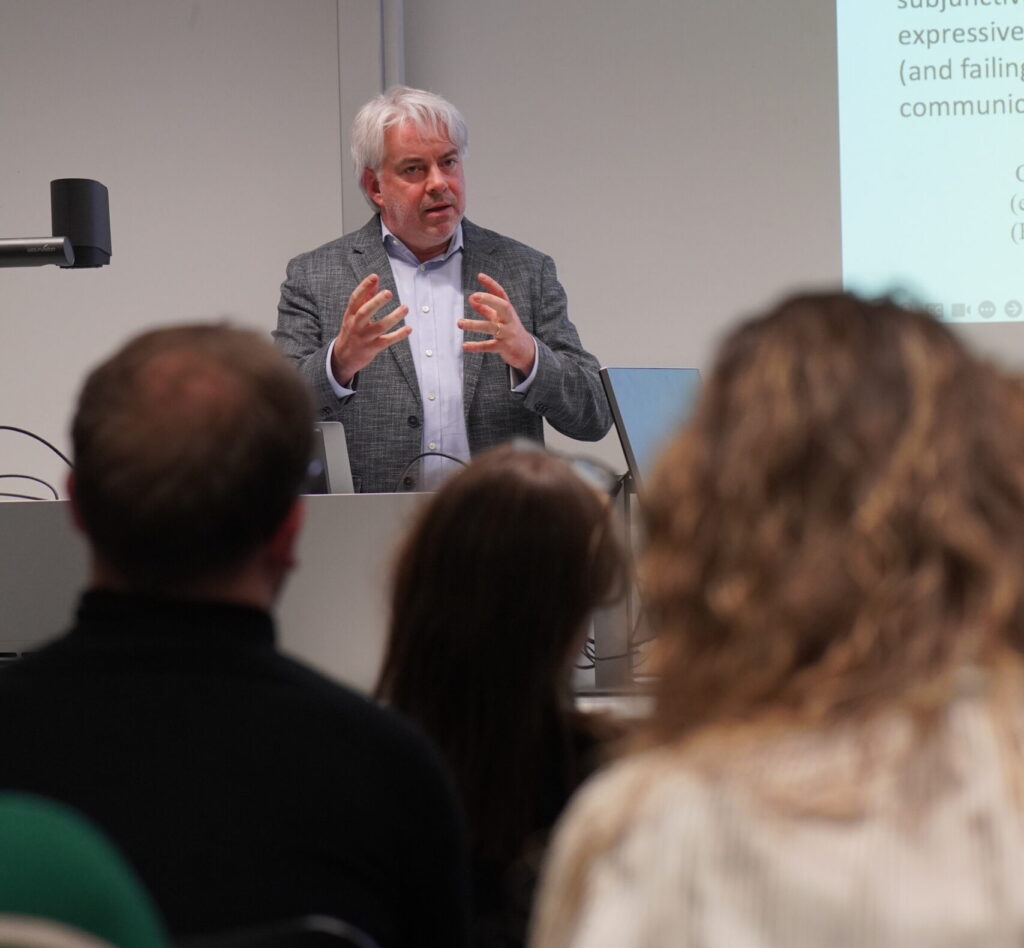
Abschließend wandte sich der Experte für digitale Geschichtswissenschaft und Public History den Konsequenzen zu, die sich aus der Fülle an dokumentarischer Evidenz durch die Echtzeitarchivierung für die Geschichtsschreibung und die Erinnerungskulturforschung ergeben. Zum einen warf er die Frage auf, ob eine Geschichtsschreibung in Echtzeit überhaupt möglich sei, da das Wesen jeder historiographischen Praxis darin bestehe, sich ihrem Gegenstand in kritischer, auch zeitlicher Distanz zu nähern. Zum anderen fragte sich Fickers, ob Digital Historians, die heute versuchten, digitale Zeugnisse in Gedächtnisbanken zu sammeln, diese tatsächlich für die künftige Forschung bewahrten oder nicht vielmehr in ein „kustodiales Vergessen“ (Aleida Assmann) verstrickt seien. So werde sowohl in der Geschichtswissenschaft als auch in der Öffentlichkeit der Frage digitalen Vergessens zu wenig Beachtung geschenkt. Entgegen der weit verbreiteten Meinung, das Internet vergesse nichts, zeigten Studien, dass bereits nach zwei Jahren die Hälfte aller Hyperlinks nicht mehr funktioniere. Auch die durchschnittliche Lebensdauer einer Webseite betrage nur acht Monate. Fickers gab zu bedenken, dass auch viele der „living archives“ webbasiert seien und generell das exponentielle Wachstum neuer Datenmengen die Tendenz zur Selbstauflösung digitaler Quellen verdecke.
Ob es Historiker:innen in 20 Jahren gelingen werde, die Geschichte der „breiten Gegenwart“ mit Hilfe der Quellen heutiger Echtzeitarchive zuverlässig zu rekonstruieren, sei eine offene Frage. Nötig sei dazu, so Fickers abschließendes Plädoyer, ein intensiverer Austausch zwischen Geschichts- und Archivwissenschaft.
Bildnachweis: © Anna-Elena Schüler

Debatten & Positionen zur Erinnerungskultur
Die Vortragsreihe soll allen Interessierten verschiedene Perspektiven der Erinnerungskultur zugänglich machen und eine Möglichkeit zum Austausch bieten.




